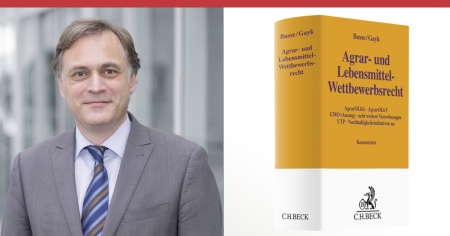Zu wenig Fairness in der Lebensmittellieferkette: Herausforderungen und Perspektiven des AgrarOLkG
von , veröffentlicht am 24.06.2024Ein Gastbeitrag von Dr. Andreas Gayk, Mitherausgeber des Kommentars Busse/Gayk, Agrar- und Lebensmittel-Wettbewerbsrecht.
Ein Supermarkt storniert über Nacht die Bestellung von Salat, bezahlt gelieferte Ware erst nach Monaten oder schickt Waren, die er nicht weiterverkaufen konnte, an den Lieferanten zurück, ohne für sie zu bezahlen. Solche Verhaltensweisen sind seit 2021 als unlautere Handelspraktiken (Unfair Trading Practices – UTP) zu Lasten der Lieferanten verboten: Das Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz (AgrarOLkG) will die Verhandlungsposition der Landwirte gegenüber dem hochkonzentrierten Lebensmittelhandel stärken und damit faire Bedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette schaffen. Bereits drei Jahre nach Inkrafttreten des AgrarOLkG steht eine Novellierung bevor – das Gesetz soll weiterentwickelt werden, um die Verhandlungsmacht des Lebensmitteleinzelhandels weiter einzugrenzen.
Dabei ist die Entscheidungspraxis zu dem Gesetz schmal und die Frist für die Messung von realen Auswirkungen sehr kurz. Doch das Gesetz schreibt diese kurzfristige Überprüfung vor und erzwingt durch die Befristung von Regelungen zum Anwendungsbereich eine politische Entscheidung. In diesem Kontext wird über die Einführung einer Generalklausel debattiert. Dadurch wird an der sensiblen Schnittstelle von Agrar-, Kartell- und Lauterkeitsrecht auch die dogmatisch grundsätzliche Frage des Verhältnisses von Kartell- und Lauterkeitsrecht in Machtkonstellationen aufgeworfen. Das verdient besondere Aufmerksamkeit, wirkt es doch potenziell weit über den Bereich der Lebensmittellieferketten hinaus.
Hintergrund und Anwendungsbereich des AgrarOLkG
Im AgrarOLkG wird die europäische UTP-Richtlinie umgesetzt, die Nachfragepraktiken in Situationen ungleicher Verhandlungsmacht verbietet. Diese Verhandlungsmacht wird pauschal durch den Vergleich von Umsatzzahlen festgestellt und erfährt in Deutschland eine komplexe produktspezifische Erweiterung, die zeitlich befristet ist und damit einen Grund für die Novelle darstellt, für die hiesige Diskussion aber nachrangig ist. Die Verbote der Nachfragepraktiken sollen die Einkommenssituation der Erzeuger verbessern. Dazu gelten sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Erzeuger über die Verarbeiter bis zum Lebensmitteleinzelhandel, um zu vermeiden, dass unfaire Praktiken nachgelagerter Wertschöpfungsstufen sich über einen Kaskadeneffekt negativ auf die Erzeuger auswirken. Selbst Erzeugergenossenschaften und Erzeugerorganisationen, die eigentlich dem Schutz der Landwirte dienen, sind nicht prinzipiell vom Anwendungsbereich ausgenommen.
Verbotene Verhaltensweisen
Die UTP-Richtlinie und ihr folgend das AgrarOLkG enthält eine abschließende Liste von Verhaltensweisen von Nachfragern von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, die ohne weitere Rechtfertigungsmöglichkeit per se verboten werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um solche Verhaltensweisen, die die Geschäftsrisiken entgegen der als typisch angesehenen Risikoverteilung einseitig zu Lasten der Lieferanten verschieben. Darunter fallen u.a. Zahlungsziele von mehr als 30 Tagen für verderbliche Lebensmittelerzeugnisse, einseitige Vertragsänderungen oder Zahlungsverpflichtungen des Lieferanten für Kosten, die nicht im Zusammenhang mit dem (Weiter-) Verkauf seiner Produkte stehen. Gerade dieses Verbot erinnert stark an das Verständnis des kartellrechtlichen Anzapfverbots in der Hochzeitsrabattentscheidung des BGH: Investitionen in die Ausstattung oder Modernisierung von Verkaufsstätten sind danach prinzipiell Sache des Händlers.
Die Regelungen zu Aktionsrabatten und Werbekostenzuschüssen greifen ebenfalls einen Gedanken des kartellrechtlichen Anzapfverbots auf. Sie müssen im Vorhinein klar und eindeutig vereinbart werden, sodass der Inhalt von Leistung und Gegenleistung unzweifelhaft feststeht. Listungsgebühren kommen darüber hinaus nur bei Markteinführungen in Betracht.
Diskussion um die Novellierung des AgrarOLkG
Ausgelöst durch die Befristung des erweiterten Anwendungsbereichs und die kurze Evaluierungsfrist hat keine drei Jahre nach Inkrafttreten des AgrarOLkG die Diskussion um die Novellierung schon wieder begonnen. Für eine Bewertung der Auswirkungen des Gesetzes standen dem BMEL aber lediglich 8 abgeschlossene Verfahren der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft als Durchsetzungsbehörde zur Verfügung und die Selbsteinschätzung der betroffenen Unternehmen. Die Grundlage für eine Bewertung des Gesetzes ist also schmal, die Frist zur Bewertung der Auswirkungen kurz. Folgerichtig setzen sich die Debatten um die richtige Ausgestaltung des deutschen UTP-Rechts fort, die schon bei der Entstehung geführt worden sind. Deshalb erscheint Zurückhaltung angezeigt. Immerhin zeigen Diskussionen und Unternehmenspraxis aber erhebliche Unsicherheiten über Inhalt und Reichweite der Vorschriften des AgrarOLkG, die eine Klärung durch den Gesetzgeber sinnvoll erscheinen lassen. Die Fragen betreffen jeweils Details der Einzelregelung, wie besonders der Abgrenzung entgeltlicher Erwerbsvorgänge von Kommissionsvereinbarungen und ähnlichen Vermittlungskonstellationen zur Bestimmung der Reichweite des Retourenverbots des § 12 AgrarOLkG. Grundlegender ist die Frage, wie mit immer wieder neuen Ausweich- und Umgehungsbestrebungen umgegangen werden soll. Dazu wird erwogen, unlautere Handelspraktiken durch eine Generalklausel umfassend zu verbieten.
Auswirkungen des AgrarOLkG auf Kartell- und Lauterkeitsrecht
Bereits mit der autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, über die zwingenden Vorgaben der UTP-Richtlinie hinauszugehen, wird die von BeckOK UWG/Fritzsche UWG § 4a Rn. 14 bereits aufgeworfene Frage nach dem Verhältnis von Kartell- und Lauterkeitsrecht virulent. Das gilt umso mehr, wenn eine Generalklausel erwogen wird:
Die UTP-Richtlinie ist trotz der Nähe zum deutschen kartellrechtlichen Anzapfverbot nicht als Kartellrecht ausgestaltet, sondern als Lauterkeitsrecht. Sie macht Vorgaben für individuelle Geschäftsbeziehungen gerade unabhängig von den tatsächlichen oder vermuteten Auswirkungen auf den Wettbewerb am Markt. Das aber sind nach dem Verständnis der Kartellverfahrensordnung und des Grünbuchs der Kommission über unlautere Handelspraktiken lauterkeitsrechtliche Regelungen.
Mit der überschießenden Umsetzung der Richtlinie findet die europäische Differenzierung zwischen Wettbewerbsrecht und Lauterkeitsrecht Eingang auch in das autonome deutsche Recht. Es entsteht ein weiterer Grund, die nach deutschem Verständnis zur alten Generalklausel des § 1 UWG traditionell angenommene Sperrwirkung des Kartellrechts gegenüber der Anwendung des Verbots aggressiver Geschäftspraktiken aufzugeben.
Dieses Eingeständnis eröffnet zugleich die Möglichkeit, die Entstehung paralleler, z.T. aber eben sektorspezifischer Generalklauseln im B2B-Lauterkeitsrecht zu vermeiden, ohne den Gedanken einer umfassenden Regelung der Ausnutzung von Machtungleichgewichten in den Verhandlungen der Agrar- und Lebensmittellieferkette aufzugeben: Das Verbot aggressiver Geschäftspraktiken des § 4a Abs. 1 Nr. 3 UWG kann in die Liste des § 23 S. 2 AgrarOLkG aufgenommen, die BLE mit seiner Durchsetzung im Anwendungsbereich des AgrarOLkG betraut werden.
Zu mehr Informationen zum Werk: Agrar- und Lebensmittel-Wettbewerbsrecht
Hinweise zur bestehenden Moderationspraxis
Kommentar schreiben